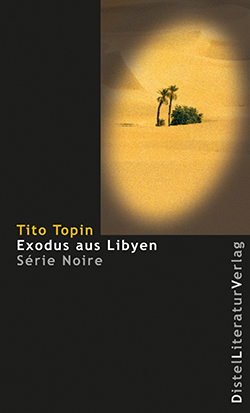Sie sind Acht. Unterschiedlicher Herkunft und Religion, aus unterschiedlichen sozialen Milieus, von verschiedenem Alter und Charakter. Sie alle wollen mitten im libyschen Bürgerkrieg Tripolis verlassen. Gemeinsam in einem Land Cruiser, unter Beschuss, in sengender Hitze. Quer durch die Wüste in Richtung Tunesien.
Der Fahrer Chino ist zum Tode verurteilt, der Arbeiter Ousmane aus dem Tschad eingewandert und hier wegen Brotdiebstahls verurteilt, der Alkoholiker Dr. Hitchcock, der dem Staatschef das Leben gerettet hat, ist ebenso auf der Flucht wie der im Flug abgeschossene französische Pilot Ventura, der Bankräuber Sharif, der französische Betrüger und falsche Archäologe Mouillon, die Schauspielerin Salima, die ein Attentat auf den Staatschef versucht hat, und die vom Staatschef geschwängerte Krankenschwester Wardia.
Wegen einer Reifenpanne müssen sie in einem von den Regierungstruppen zurückeroberten Dorf Rast machen und in der Ruine eines Hotels übernachten, in dem ausgerechnet auch der Kommandant der Besatzungstruppe logiert.Nun nimmt kein griechisches, so aber ein ganz reales libysches Drama seinen Lauf. "Was für eine schöne Zivilisation wir doch haben, die ihren Kindern Angst macht und ohne Ende Waffen verkauft, auf denen sie vergessen haben anzugeben, dass ihr Gebrauch tödlich ist."
e-Book - Version (E-Pub)
(Ihre Bestellung wird ausgeführt durch die Germinal Medienhandlung GmbH.)
Exodus aus Libyen
1
Die Sonne steht hoch, der Himmel ist wolkenlos blau, die Atmosphäre von einer seltenen Vollkommenheit. Zwei Frauen tauschen von Fenster zu Fenster Eindrücke aus, während sie ihre Wäsche auf vor der Fassade gespannte Leinen hängen. Aus der vierten Etage ertönt der gutturale Schrei eines im Käfig gehaltenen Papageien, das Bellen eines Hundes antwortet ihm, die Lautsprecher hoch oben auf den Minaretts stoßen ihre Aufrufe aus. Mitten auf der nach den Gezeiten, angebranntem Fett und nach Fisch stinkenden Straße malt ein kleines Mädchen mit leuchtenden Augen mit einem Stein das Hüpfspiel «Himmel und Hölle» direkt in die Erde. Im Rinnstein trocknet eine Blutlache vollends aus, der Körper ist verschwunden, übrig ist nur ein Schuh mit Löchern in der Sohle. Ein Schwarm fliegender Schaben schwirrt aus einem Gully hervor und verdunkelt die angrenzende Straße mit einem sich bewegenden Schatten, unter dem Taxis, qualmende Lastwagen, knatternde Motorroller, Pferde- und Eselskarren, Fußgänger, brechend volle Kleinbusse und schwer beladene Autos sich vermengen und kreuz und quer fortbewegen: die totale Anarchie.
In diesem urbanen Chaos stürzt sich der Fahrer des Land Cruisers mit durchgedrückter Hupe in den Verkehr, erzwingt die Durchfahrt, donnert über den Gehsteig, schert sich einen Dreck um Ampeln. Abbremsen kommt nicht infrage, anhalten würde bedeuten, sich in Gefahr zu bringen. Am Vortag sind im Zentrum drei Busse von schwerbewaffneten Männern überfallen worden, als sie an roten Ampeln hielten. Die Passagiere wurden ausgeraubt, mehrere mit roher Gewalt, ein Junge wurde getötet, eine Frau kam ins Krankenhaus.
Der Fahrer nennt sich Chino wegen seinen Mandelaugen unter den Lidern, aber das ist nicht sein richtiger Name, sein richtiger Name steht auf der Liste der zum Tode Verurteilten. Seite 225, Abs. 3. Iken Massima. Nur ein «k» statt zwei. Unfähig, seinen Namen richtig zu schreiben. Er ist ein großer Kerl, hager, knorrig, ohne Fett. Muskeln, Nerven und Sehnen kommen auf seiner schwarzen Haut zum Vorschein. Die breite Brust unter dem zerrissenen Unterhemd ist ein Gewirr aus Knoten, die sich bei jeder Bewegung ineinander verschlingen und zusammenziehen wie ein Vipernnest. Sein Bart ist ganz neu, pechschwarz, kein weißes Haar. Er wird ihn erst nach dem Tod des Pourriture* abnehmen. Das hat er Izza versprochen.
«Du wirst aussehen wie ein Fundamentalist», hatte sie gesagt.
«Die haben kein Monopol auf einen Bart», hatte er erwidert. «Victor Hugo war kein Fundamentalist, Maimonidis und Aristoteles auch nicht.»
«Wie kommst du denn auf die? Ein Christ, ein Jude und ein Grieche, seit Jahrhunderten tot!»
Sie hatten gelacht.
Neben ihm auf dem Beifahrersitz, in Hemdsärmeln, ein Baumwollblouson lässig über die Knie geworfen, sitzt Henri Ventura und betrachtet das heillose Chaos durch die Windschutzscheibe. Er hat keinerlei Gepäck. Er lässt das Fenster runter, als zwei französische Rafale-Kampfjets in sehr niedriger Höhe vorüberfliegen. So niedrig, dass er die Nextor-Kanone unter dem rechten Flügel des Jagdbombers erkennen kann, die, wie er weiß, bis zu 2500 Granaten pro Minute abfeuern kann. Und so schnell, dass er die Piloten nicht mit Sicherheit erkennen konnte. Das ist normal, er kennt die von der Staffel nicht gut, außer Michel natürlich, und Charlie, aber Michel ist in Neapel und stopft sich mit Pizza Margherita voll, begossen mit Limoncello, und Charlie dürfte wohl tot sein, wenigstens muss man es ihm wünschen, es wäre besser für ihn. Dichter, schwarzer Rauch steigt über Bab-al-Azizyah, der Residenz des Pourriture auf. Die Kameraden haben den Job erledigt, der eigentlich seiner hätte sein sollen, denkt er und kurbelt das Fenster wieder hoch.
Das Gesicht männlich, wettergebräunt von der Sonne und dem Sport an der frischen Luft, das Haar im Bürstenschnitt, strohblond, die Augen strahlend blau. Er ist mittelgroß, hält sich gerade auf seinem Sitz, so dass er größer wirkt. Lolita behauptete, er sähe Vincent Cassel, dem Schauspieler, ähnlich, aber ihr Urteilsvermögen war getrübt, sagten ihre Freunde: sie war verliebt. Seine Ganovenvisage hat mich verführt, antwortete sie, wenn sie gefragt wurde, wie sie, als Cineastin und Spezialistin über Coppola, dem sie zwei Werke gewidmet hatte, einen Piloten der Luftwaffe heiraten konnte, einen Berufssoldaten, der nie einen Film gesehen hatte außer im Fernsehen, unterbrochen von aufdringlicher Werbung. Sie kannten sich seit ihrer Jugend. Er kehrte aus Afghanistan zurück. Geheiratet nach wenigen Tagen. Ein Strohfeuer. Alles war so kurz gewesen.
Er zündet eine Zigarette an, darauf bedacht, sie nicht anzufeuchten, und reicht sie über die Schulter Ousmane hinter ihm.
Ousmane lehnt ab, er raucht nicht, er hat nie geraucht, erklärt er in einem Englisch, das von einem grauenhaften Akzent gefärbt und nicht immer verständlich ist. Die Religion?, erkundigt sich Henri. Die Armut, erwidert er.
Ousmane behauptet, er sei aus Benghasi. Sein nomadisches Aussehen lässt das glaubhaft erscheinen, aber in Wirklichkeit stammt er aus einem Elendsviertel von Faya-Largeau im Tschad.
Ohne zu warten, dass sie ihm angeboten wird, streckt Emmanuel Sharif die Hand aus und schnappt sich die angezündete Zigarette aus Venturas Fingern. Danke, sagt er und setzt eine Unschuldsmiene auf, was er bis zur Perfektion beherrscht.
Bei dem vierten Insassen des dicken Toyotas ist alles gummiartig, seine Nase, seine Augen, seine Hände, seine Füße, seine Ein-Meter-Neunzig, die er herablassend beugt, wenn er mit kleineren Menschen spricht. Er stellt einen wirren, weißen Haarschopf zur Schau, obwohl er erst zweiundvierzig ist. Er trägt eine Brille, die er überhaupt nicht benötigt. Das Gestell ist aus Metall, dünn und leicht oval wie das eines russischen Revolutionärs zu Lenins Zeiten. Die farblosen Gläser ohne Sehstärke verleihen ihm das Aussehen eines Intellektuellen. Seiner Meinung nach sind die Intellektuellen in den Augen der Leute nicht gefährlich, außerdem ist das eine gute Tarnung. So, wie er da sitzt, erinnert seine schlaffe, entspannte Gestalt an einen Spargel, der einer Genmanipulation unterzogen wurde. Seine Tasche steht an seinen Füßen. Sie ist sperrig, länglich, verziert mit dem Siegel der Firma Vuitton. Eine plumpe Fälschung. Seine Finger umschließen den Taschenriemen.
Chino hat die anderen Passagiere in das alte italienische Viertel in der Nähe des Hotels Al-Safwa an der Ecke der Straßen Baladiyah und Karachi bestellt, ein Sektor, der bislang von den Luftangriffen der Koalition verschont geblieben ist. Als er ankommt, stellt er den Motor ab und macht sich durch ein langes Hupen bemerkbar. Zwei Männer tauchen auf.
Auf einem von Plumbagos beschädigten Mäuerchen unter dem dürftigen Schatten eines Peruanischen Pfefferbaums sitzt Doktor Kenneth Hitchcock, seine Arzttasche aus altem Leder und einen Rollkoffer zu seinen Füßen. In der Eile hat er nur das Allernötigste mitgenommen, etwas Unterwäsche zum Wechseln, Toilettenartikel, seine Medikamente gegen Bluthochdruck, einen Sammelband von Graham Greene, der insbesondere The Power and the Glory enthält, das er im Gefängnis zu lesen angefangen hatte, zwei Flaschen Whisky, teuer von einem Slowenen erstanden, und einen Aluminiumbecher, weil er es hasst, aus der Flasche zu trinken, eine Frage der Erziehung. Fett, dickbäuchig, die Augen versteckt unter schweren Lidern, sarkastischer Blick, hängende Lippen, bissiger Mund, sorgfältig gestutzter, ergrauender Dreitagebart, wischt er sich das Gesicht mit einem Taschentuch ab, auf das seine Initialen gestickt sind, wie es sich für einen Mann seines Standes schickt. Wenn er gähnt, wabbeln die Hängebacken wie Wackelpudding und fallen vorhangähnlich auf jeder Seite seines Gesichts herab, vereinen sich mit der schwammigen Masse des Doppelkinns.
Er stützt sich an der Mauer ab und steht auf, klopft sich den Staub vom Hosenboden.
Gleichzeitig ist auf der anderen Straßenseite ein Mann aufgestanden.
Er ergreift einen großen, mit einem Zahlenschloss verriegelten Hartschalen-Koffer mit Rollen, dessen rote Farbe von der Sonne angegriffen ist. Eine Digitalkamera hängt an einem Riemen vor seiner Brust. Er hat die Kleidung von der Ausgrabungsstelle anbehalten, die er im Landesinneren geleitet hat, das heißt einen unförmigen Hut mit Salzflecken vom Schwitzen, eine khakifarbene Drillichhose mit zwei vollen Taschen an den Seiten der Oberschenkel, eine offene Saharaweste, bei der eine Epaulette herabbaumelt, darunter einen sandfarbenen, sonnengebleichten Baumwollpulli mit Rundhalsausschnitt. Der Mann ist klein, das Gesicht ledern und grobschlächtig, die Knochen sind hervorspringend, die Haare schwarz und glatt, die Augen grau hinter dem Glas der Hornbrille.
«Jean-David Mouillon», stellt er sich vor und ver-traut Chino seinen Koffer an, bevor er in den Wagen klettert.
Ton und Haltung von jemandem, der es gewohnt ist, Befehle zu erteilen.
Seine Arzttasche in einer Hand, den Rollkoffer mit der anderen hinter sich herziehend, kommt Kenneth Hitchcock gemächlich herbei.
«Machen Sie es sich bequem», sagt Chino, nachdem sie ein paar Höflichkeitsfloskeln auf Englisch ausgetauscht hatten.
«Ich bleibe lieber draußen», grummelt Hitchcock mit jener rauen Stimme, die auf einen exzessiven Alkohol- und Tabakkonsum schließen lässt. «Da drin ist ja der reinste Ofen», fügt er hinzu und setzt sich auf das Trittbrett des Land Cruisers.
Dabei sind die Türen offen geblieben, um Durchzug zu schaffen.
«Worauf warten wir noch?», fragt Emmanuel Sharif mit einem Blick auf die Uhr, die gleiche, die Steve MacQueen in Le Mans trug, eine TAG Heuer, die er in Old Cataract d’Assouan gewonnen hatte, dank eines Full House mit Damen über eines mit Buben.
«Die Frauen», antwortet Chino mit einem Schulterzucken. «Wir warten auf die Frauen.»
Angewiderter Blick von Sharif.
«Was für Frauen? Ist das dein Ernst?»
«Sie müssten gleich da sein», erklärt Ventura ohne große Überzeugung.
«Zwei Frauen, eine von ihnen schwanger», erläutert der Fahrer.
«Das hat gerade noch gefehlt», höhnt Sharif. «Wenn sie bloß nicht unterwegs niederkommt. Ich hab diesen Weg schon einmal gemacht, das ist kein Spaziergang.»
«Vorn ist es bequemer für sie», sagt Ventura und erhebt sich. «Soll sie meinen Platz nehmen.»
«Nein, bleib», sagt Chino. «Vielleicht brauch ich dich.»
«Ist es dir lieber, wenn sie während der ganzen Reise kotzt?»
Er steigt aus und setzt sich auf die zweite Rückbank, als er ein Hupen hört und den Kopf wendet.
Ein Hyundai Minibus hält neben dem Land Cruiser. Eine junge Frau steigt aus: unruhige Miene, der Blick wachsam, der Gang unsicher auf hohen Absätzen. Sie scheint erleichtert, als sie Chino erkennt, eilt auf ihn zu, hält ihm einen Passierschein unter die Nase und klettert in den Wagen. Wortlos setzt sie sich neben Henri Ventura.
Er bietet ihr eine Zigarette an und mustert sie, während sie sich bückt und eine Tasche zwischen ihre Beine klemmt. Sie hat eine gewölbte Stirn, umspielt von schwarzen Locken, die aus dem Kopftuch hervorlugen, einen kohlschwarzen Blick, hohe Wangenknochen, eine hübsch gebogene Nase, einen ockerfarbenen Teint, volle Lippen. Sie könnte einem Gemälde von Hugo Pratt entsprungen sein. Wie alt ist sie wohl? Zweiundzwanzig, fünfundzwanzig? Nein, keine zwanzig, denkt er, als er ihre Hände betrachtet. Kinderhände.
Sie richtet sich wieder auf, fischt eine Zigarette aus der Schachtel, die er ihr reicht, und neigt ihr Gesicht dem Feuerzeug entgegen.
«Danke», sagt sie inhalierend.
«Ich heiße Henri.»
«Salima.»
Er hat gehört, dass arabische Frauen nicht rauchen, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit, außer den Huren. Sollte sie also eine Hure sein? Er hat keinerlei Erfahrung mit Prostituierten, daheim hat er keine gekannt. Sie würde wie eine Spanierin aussehen, wären da nicht das Kajal um die Augen, das bestickte Kopftuch und das hennafarbene Tattoo einer stilisierten Hand, eine Khamsa, auf dem rechten Handrücken.
«Das bringt Glück», sagt sie, als sie seinen Blick bemerkt.
«Das tragen Sie in sich.»
«Was?»
«Das Glück.»
«Was soll der Quatsch?»
Der eisige Ton, die plötzliche Verärgerung.
«Nein, ich meine es ernst.»
Sie hatte gedacht, er würde sie anbaggern. Und wenn er ihr das Foto von Lolita zeigen würde, das er in sei-nem Blouson hat? Das, auf dem sie beide posierten, schön und braungebrannt, vor einem ehemaligen Ko-lonialhaus in Charlston, wo sie ein Wochenende in einem Motel in der Meeting Street verbracht hatten. Die Veranda aus weißem Holz wirkt wie Spitzenbesatz an der von einer Kaskade aus Bougainvilleas belebten Fassade, vorne auf ganzer Länge ein Gärtchen. Sie hatten einen brasilianischen Touristen gebeten, das Foto aufzunehmen. Schauen Sie, Mademoiselle Salima, das ist meine Frau. Nein, das stimmt nicht, er bedeutet ihr nichts mehr. Charlie, dieses Arschloch.
Er vermeidet es, sie anzusehen.
«Das ist gegen den bösen Blick», erklärt sie. «Nichts weiter.»
Er nickt zustimmend, ohne weiter darauf einzugehen, den Blick auf die staubigen Palmen gerichtet, deren Palmwedel träge vor dem Hintergrund des blauen Himmels hin und herschwingen. Dieses Land stimmt ihn melancholisch.
Ein Sammeltaxi fährt an dem Land Cruiser entlang, zieht vorbei, bremst, setzt zurück. Die Tür geht auf und eine Frau steigt schwerfällig aus, sie wirkt abgehetzt, ihr Blick ist sorgenvoll.
«Entschuldige», sagt sie auf Arabisch zu Chino und erklärt mit abgehackter Stimme, dass sie gern angerufen hätte, wenn sie seine Nummer gehabt hätte.
Sie war beim Planetarium an einer Straßensperre aufgehalten worden und hatte sich nur durch ein saftiges Schmiergeld an den Unteroffizier freie Fahrt verschaffen können, daher ihre Verspätung.
Sie versucht zu lächeln, jedoch nicht sehr überzeugend. Ihre Brust hebt und senkt sich schnell.
«Die Korruption ist schuld an der Revolution», sagt sie und fächelt sich mit der Hand Luft zu, «aber wer kann schon glauben, dass es danach keine Korruption mehr gibt? Niemand.»
«Wie heißt du?»
«Wardia Tasantani.»
«Ist gut», sagt er. «Wir haben dir vorn einen Platz freigelassen, neben mir. Warte, ich helf dir beim Einsteigen. Gib mir deinen Koffer.»
«Die wird es immer geben», fährt sie fort und schöpft Atem.
Ein Hund läuft an Kenneth Hitchcock vorbei, der auf dem Trittbrett sitzt. Die Art gelber Hund, der keiner bekannten Rasse angehört oder sie vielmehr alle in sich trägt, zu homöopathischen Anteilen.
Er läuft auf drei Pfoten, die vierte ist am Unterschenkel auf halber Höhe abgetrennt. Er bleibt an der Bordsteinkante stehen, zögert, die Straße zu überqueren, gibt dann angesichts des starken Verkehrs auf. Er kehrt um, setzt sich vor Hitchcock auf sein Hinterteil und wirft ihm einen flehenden Blick zu, einen menschlichen Blick.
«Auf geht’s, Doktor», sagt Chino und hebt einen kleinen Stein auf, um den Hund zu verjagen.
«Nicht», sagt Hitchcock und hält seinen Arm zurück.
Er stützt sich mit den Händen auf den Knien ab, steht schwerfällig auf und geht mit den Fingern schnalzend auf das Tier zu, das wieder aufsteht und ihm humpelnd folgt. Der massige Mann hebt den Arm in Richtung der Autos und überquert die Straße im Zickzack zwischen den Flüchen und Protesten der Hupen, dicht gefolgt von dem verstümmelten Hund, der mit dem Schwanz wedelt. Auf der anderen Seite angekommen, lässt er das Tier davonrennen und kehrt auf dieselbe Weise zurück.
«Das war mein Bruder», erklärt er, als er zu Chino und den anderen Fahrgästen zurückkommt, die ihm mit ungläubigem Blick gefolgt sind. «Wenn die Menschen sich alle gegenseitig umgebracht haben, können die Hunde sich aus ihrer Lage befreien und eine schöne Zivilisation auf den Ruinen der unseren aufbauen, und wissen Sie, warum sie schön sein wird? Weil die Hunde sich nicht mit dem Gedanken an Gott belasten, die scheißen drauf, und ich wette, dass sie weder Kathedralen noch Moscheen noch sonst irgendetwas in der Art errichten werden.»
Chino öffnet den Mund in der Absicht, sich solche Reden zu verbitten, solange sie zusammen sind, überlegt es sich dann aber anders und schweigt. Er wird es ihm später sagen. Dies ist nicht der Moment für Diskussionen.
Er lädt das Gepäck hinten in den Wagen.
«Pass auf meinen Koffer auf», protestiert Mouillon und hebt die Arme zum Himmel.
Chino antwortet nicht, er verstaut das Gepäck, hilft der jungen, schwangeren Frau auf den Vordersitz, setzt sich ans Steuer und lässt den Motor an.
Bevor er losfährt, legt er seinen Revolver in die mittlere Armlehne.
«Mein Gott», ruft Wardia mit weit aufgerissenen Augen.
Chino bedeutet ihr mit einem leichten Taps auf den Handrücken zu schweigen.
«Rühr' mich nicht an! Kapiert?», schreit sie empört.
Ihr Handy klingelt. Sie holt es aus der Tasche.
Er nimmt es ihr aus der Hand und unterbricht die Verbindung.
«Antworten Sie nicht, wenn Sie angerufen werden», sagt er an die Fahrgäste gewandt. «Das ist klüger. Sie könnten uns lokalisieren.»
«Sie haben doch keinen Grund, uns zu suchen», sagt die schwangere Frau entsetzt.
«Sei still», erwidert er und gibt ihr das zum Schweigen gebrachte Telefon zurück.
Hinten drängt Salima sich gegen Henri Ventura, um Ousmane mehr Platz zu machen.
Der Wagen beschleunigt. Festgesaugt an der Innenseite der Windschutzscheibe grüßt unermüdlich eine Gummihand, der ein Finger fehlt.
Die Stadt sprudelt nur so vor Geschäftigkeit über, als müsste sie die Zeit wieder aufholen, die sie durch die von den Bombenangriffen verursachten Unterbrechungen verloren hat. Sie dröhnt von den Rufen an die Kunden, vom Lärm der Motoren, den Klimaanlagen, den Hupen, den Sirenen der Krankenwagen, Feuerwehr- und Polizeiautos, von der Musik, die aus den Läden dringt. Ein schwerer Gestank dringt aus den Mülltonnen und Gullys. Berge von Abfall gären in der Sonne, die Autos heizen die Luft auf, der Asphalt schmilzt, das Straßenpflaster glüht. Die Hand unablässig auf der Hupe, bahnt Chino sich schlecht und recht einen Weg zwischen den Lastern, die so schwer beladen sind, dass ihre Radachsen die Straße streifen, zwischen den wahnwitzigen Minibussen, den kleinen dreirädrigen Zweitaktern, den Esels- und Pferdekarren, gelenkt von Bauern, die dem Kampfgebiet im wilden Galopp zu entfliehen suchen, den Autoskooter spielenden Taxis, den der Gefahr trotzenden Fußgängern. Der Tumult ist unbeschreiblich. Ein seinen Deichselstangen entwischtes Muli wirft einen Stand um, stürzt sich in den Verkehr, stößt gegen den Land Cruiser und verfolgt weiter seinen verrückten Lauf. Wer in diesem Chaos leichtfertig an einer Ampel stehen bleibt, riskiert Kopf und Kragen.
Plötzlich lassen ohrenbetäubende Explosionen, verstärkt durch das dröhnende Ausstoßen der Flugabwehrbatterien einige Scheiben in alten Fenstern zerspringen. Zwei Kampfflugzeuge jagen mit furchteinflößendem Donnern Richtung Meer. Ein Pferd bäumt sich auf, der Karren kippt um und befreit hunderte an den Füßen zusammengebundene Hühner. Wahre Sträuße aus Geflügelfleisch. Erneute Explosionen, näher diesmal. Weitere Flugzeuge tauchen plötzlich auf und verschwinden mit Blitzgeschwindigkeit. Eine Palisade stürzt ein, die Markise einer Apotheke reißt ab, eine Kleiderauslage fliegt fort. In wenigen Sekunden leert sich die Straße.
Der Land Cruiser macht sich davon.
Mit Vollgas braust Chino in die Rue Gourgi hinein, die nach Bab Gargarech führt, und meidet so die Straßensperren auf den großen Verkehrsachsen.
Ein Triumphbogen, hervorgehoben durch ein gewaltiges Portrait des Pourriture, zeichnet sich in der Ferne ab. Die Farben sind plakativ, die Malerei ist naiv, stellenweise rissig.
Am Straßenrand steht ein sowjetischer T-34 E Panzer, die Kanone auf die Stadt gerichtet. Etwa zehn regierungstreue Söldner, Kalaschnikows quer über der Brust, kontrollieren Ein- und Ausgänge, konfiszieren die Papiere, legen sie ihrem mit einem dünnen Schnurrbart ausgestatteten Chef vor, der an einem kleinen Tisch vor einer Reihe Stempelkissen sitzt. Eine endlose Schlange Laster wartet mit ausgeschaltetem Motor auf ihr Verdikt. Vier Fahrer hocken gleichmütig rund um eine Schüssel Ba-zeen auf dem Boden und spielen Karten. Während der Spielpausen nehmen sie mithilfe eines Stücks Fladenbrot die Paste aus Gerstenmehl auf und tunken sie in eine Sauce aus Gemüse, Fleisch und hartgekochten Eiern, bevor sie das Ganze zum Mund führen.
«Deine Papiere», sagt ein Soldat und streckt eine ungeduldige Hand an die Autotür.
«Wir sind auf dem Weg zu einer Hochzeit in Zouara», erklärt Chino lächelnd.
«Deine Reiseberechtigung.»
«Eure Passierscheine», übersetzt Chino an seine Passagiere gewandt.
«Ich rede mit dir», entgegnet der Soldat schneidend.
Chino faltet einen Hundert-Dinarschein, steckt ihn in seinen Führerschein und reicht beides durch die Autotür.
Der Soldat steckt den Schein ein, behält den Führerschein.
«Aussteigen.»
Unbeugsame Haltung, der Ton ohne jede Liebenswürdigkeit.
«Ich habe dir meine Papiere gezeigt.»
«Aussteigen!»
«Ich hab noch mehr davon.»
«Das reicht, aussteigen! Alle aussteigen! Y'alla, fissa!»
«Na, na, ich habe doch die Papiere, ich bin in Ordnung.»
Chino tut, als würde er dem Befehl Folge leisten, klappt die mittlere Armstütze hoch, schiebt mit einem Finger die Revolvertasche zurück, nimmt den Revolver heraus und spannt den Hahn, während er weiterredet, um das Klicken zu übertönen.
Wardia reißt den Mund auf.
Mit einer Bewegung der Augenlider bedeutet er ihr, nicht zu schreien und wendet sich wieder an den Soldaten.
Die Kugel trifft ihn mitten ins Gesicht und reißt ihm die halbe Schädeldecke weg.
Anmerkung
*Pourriture: Verderbtheit, (moralische) Korruptheit. Mit diesem Begriff umschreibt der Autor den Staatschef (Anm. d. Übers.).
Exodus aus Libyen
Die totale Anarchie
Goodbye Gaddafi: Der aus Marokko stammende französische Autor Tito Topin schickt in «Exodus aus Libyen» eine ziemlich bunte Reisegesellschaft in die Wüste - und lässt das Roadmovie in einem rasanten Showdown enden.
Was man von guten Krimis lernen kann: Erzählökonomie. Ein paar Striche, nicht zu dick und nicht zu dünn, und schon hat der Leser ein Bild vor Augen, einen Geruch in der Nase: «Ein Schwarm fliegender Schaben schwirrt aus einem Gully hervor und verdunkelt die angrenzende Straße mit einem sich bewegenden Schatten, unter dem Taxis, qualmende Lastwagen, knatternde Motorroller, Pferde- und Eselskarren, Fußgänger, brechend volle Kleinbusse und schwer beladene Autos sich vermengen und kreuz und quer fortbewegen: die totale Anarchie.»
Zoom auf eines der Autos, einen Toyota Land-Cruiser. Er wühlt sich durch den Verkehr, sammelt noch ein paar Mitfahrer ein, und bald sind sie komplett, sechs Männer und zwei Frauen, die alle so schnell wie möglich aus Tripolis raus und nach Tunesien wollen, in Sicherheit, denn hier, in Libyen, liefert sich Gaddafis Armee die letzte Schlacht mit den Rebellen. Obwohl, so ganz ist nicht abzusehen, wie lange der Krieg noch dauern wird. Und von den acht hat jeder einen guten Grund, sich davonzumachen. Der eine ist französischer Jagdflieger, den sein Schleudersitz gerettet hat, der Fahrer des Wagens eigentlich Lehrer und Sympathisant der Rebellen. Ein Bankräuber sitzt da auf einer der beiden Rückbänke, ein falscher Archäologe, ein betrunkener Arzt (nur betrunkene sagen die Wahrheit), eine Schauspielerin und eine schwangere Krankenschwester, die bald ihr Kind erwartet. Und dann ist da noch Ousmane, ein junger Mann aus dem Tschad, der vor nicht langer Zeit noch hoffte, im vermeintlich sicheren Libyen Geld zu verdienen, um sich daheim eine Schafherde kaufen zu können.
Die unterschiedlichsten Welten treffen in «Exodus aus Libyen» zusammen, und man kann nicht behaupten, dass diese Begegnung besonders harmonisch verläuft. Es ist eine Notgemeinschaft, die da gen Westen braust, vorbei an den Spuren des Kriegs: «Eine dicke schwarze Rauchsäule quillt aus dem Kommandoturm und den Luken eines Panzers hervor. Sie rollt sich um sich selbst und schwillt an, davongetragen von einem Wind, der aus der Wüste kommt. Ab und zu blitzt eine Flamme auf, erstickt jedoch schnell. Die Ketten liegen zerbrochen am Boden. Daneben verbrennen zwei verkohlte Körper vollends.»
Tito Topin wurde 1932 in Casablanca geboren, emigrierte Mitte der Fünfzigerjahre nach Brasilien, zog später nach Frankreich, veröffentlichte Kriminalromane, Comics, Kinderbücher und schrieb fürs Fernsehen. Von Aufenthalten in Libyen ist in seiner Biografie nicht die Rede, aber er scheint sich auszukennen in diesem Land, weiß, dass es hier Mufflons gibt und die seltene Damagazelle. Gaddafi, heißt es einmal, habe in den 42 Jahren seiner Herrschaft nur einen einzigen Krieg geführt, und diesen verloren: einen Krieg mit Tschad. In Tschad wiederum gibt es 120 verschiedene Sprachen, und als Ousmane einmal versucht mit Soldaten aus seinem Heimatland zu sprechen (fast alle Soldaten Gaddafis sind Söldner), wird er nicht verstanden: «Wenn er sie auf Ngambai anspricht, antworten sie auf Musgum, und wenn er sich trotz seiner geringen Praxis bemüht, Massa zu sprechen, antworten sie auf Bideyat.»
Verständigung ist aber nicht das Hauptproblem. Das Problem ist der Reifen des Land-Cruisers, der beständig Luft verliert. So muss die bunte Reisegesellschaft in Ar-Rahibat auf der Straße nach Nalut [...] Station machen. Ar-Rahibat wurde gerade von der regulären Armee zurückerobert und im einzigen leidlich intakten Gebäude, dem Hotel de l'Amitié, residiert der Kommandant. Und der will die Gruppe nicht weiterfahren lassen, bis die Schauspielerin nicht freiwillig zu ihm ins Zimmer kommt.
So entwickelt sich aus dem, was wie ein Roadmovie begonnen hat, ein konzentriertes kleines Kammerpiel. Mit einem klassischen Krimi hat das Ganze freilich wenig zu tun, auch wenn wie nebenbei mal ein Toter die Treppe runterpurzelt und so manches Grab noch ausgehoben werden muss, bevor es zum rasanten Showdown kommt.
In Frankreich ist «Exodus aus Libyen» bereits 2013 erschienen, keine zwei Jahre nach dem Tod Gaddafis. Da war sein Autor bereits 81 Jahre alt. Und wenn ein Alterswerk so aussieht, wie Alterswerke immer von solcher Lässigkeit, Leichtigkeit und zugleich von vergleichbarer Stringenz wären, würden wir nichts anderes mehr lesen wollen.
Tobias Lehmkuhl, Süddeutsche.de
Ich, der Flüchtling - Brutal beeindruckend: Tito Topins «Exodus aus Libyen»
Libyen, dafü muss kein Nordafrika-Experte konsultiert werden, ist ein sogenannter «failed state». Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen und formuliert dieplomatisch: "Die staatlichen Sicherheitsorgane können grundsätzlich keinen ausreichenden Schutz garantieren oder Holfe leisten. Regierungstreue, aber auch unabhängige Brigaden beanspruchen, Teile der öffentlichen Ordnung zu sichern, sind jedoch nicht ausgebildet und wenig berechenbar.»
Das heißt, weniger gewunden, dass nach Gaddafis Tod 2011 der Bürgerkrieg nicht aufgehört hat, dass es zwei Regierungen gibt, dass Clans und Milizen miteinander rivalisieren, dass sich vor allem der IS auch hier eine breite Basis verschafft hat - es herrscht Chaos im Land.
Kommt da, könnte man fragen, ein Roman, der im Jahr 2011 spielt, 2013 in Frankreich erschien und jetzt auf Deutsch herauskommt, nicht etwas zu spät? Ist nicht seine Sicht der Dinge überholt, notwendig harmloser, als die Realität von heute es erlaubt? Wer nur ein paar Seiten von Tito Topins «Exodus aus Libyen» gelesen hat, wird das tendenziell verneinen, wer den Roman beendet hat, dürfte sich sicher sein und allenfalls bezweifeln, dass für dieses Buch der Zusatz "Série noire" ideal ist. Denn was die acht Menschen, die versuchen, durch die Wüste ins benachbarte Tunesien zu fliehen, durchmachen, ist weniger eine Kriminalstory als eine Geschichte von Flucht und Überleben.
Der dreundachtzigjährige Topin, der in Marokko geboren wurde und in Frankreich lebt, ist nicht nur Schriftsteller, er hat auch als Illustrator und Drehbuchautor gearbeitet, und sein gutes Auge für visuell starke Szenen, für Verdichtung und knappe Sätze spürt man von der ersten Seite an, wenn er mit ein paar Reißschwenks das Straßenleben in Tripolis einfängt. «Im Rinnstein trocknet eine Blutlache vollends aus, der Körper ist verschwunden, übrig ist nur ein Schuh mit Löchern in der Sohle. Ein Schwarm fliegender Schaben schwirrt aus einem Gully hervor und verdunkelt die angrenzende Straße mit einem sich bewegenden Schatten."
In diesem Tempo geht es weiter, auf der Flucht ist schnelles Handeln Überlebensprinzip - nichts wie raus aus Tripolis. Topin verliert deshalb auch keine Zeit damit, sein Personal, das in einem gestohlenen Land Cruiser unterwegs ist, umständlich in kleinen Portionen und Dialogen einzuführen. Wie in einem Film, bei dem die Protagonisten auf einmal direkt in die Kamera sprechen, lässt er nacheinander jeden der acht in der ersten Person Singular in einem Kapitel sich kurz vorstellen: den Fahrer, einen Arabischlehrer und Gaddafi-Gegner, den abgestürzten französischen Luftwaffenpiloten, den zynischen kanadischen Arzt, den französischen Archäologen, den ägyptischen Gauner, den Arbeiter aus dem Tschad, die Schauspielerin mit dem dunklen Geheimnis, die schwangere Frau.
Sie entkommen den Straßensperren, den Kugeln, aber sie kommen nicht allzu weit. Ein platter Reifen lässt sie stranden in einem Kaff, das die Rebellen erobert und Gaddafis Truppen zurückerobert haben. Die differierenden Interessen und die Konflikte mit den Militärs liefern den bewährten dramatischen Brandbeschleuniger: Sie geraten aneinander, wegen Geld, Proviant, der besten Fluchtstrategie. Topin legt das Ganze fast so hart und heftig an wie Tarantino in seinem neuen Film «The Hateful 8» - mit allmählicher Reduzierung des Personals ist daher zu rechnen. Nur spielerisch geht es hier keine Sekunde lang zu, in einem Bürgerkriegsland, in dem die Zahl der Leichen ohnehin sehr hoch ist. Was da von den Plänen, Wünschen, Träumen der Einzelnen übrig bleibt, ist nicht viel.
«Meine Bücher» schreibt Topin auf seiner Webseite, «sind das Ergebnis schlechter Lektüren, langer, alkoholisierter Gespräche und großer Schmerzen.» So viel Koketterie kann auch sich einer jenseits der achtzig leisten. Nach seinem so brutalen wie beeindruckenden Roman erst recht. Und man würde nach diesem libyschen Exodus auch gerne noch weitere Bücher dieses nicht gerade reichlich übersetzten Autors kennenlernen.
Peter Körte, FAZ
Krieg kennt keine Sieger
Alle reden vom Krieg. Wir auch. Nun ist zwar Krieg für gewöhnlich ein ziemliches Blutvergießen, hat aber an dieser Stelle eigentlich nichts zu suchen. Wir wollen ja die Debatte um den Unterschied von Töten im Krieg und Töten in friedlichen Zeiten nicht weiterführen. Wir sind ja nicht verrückt. Aber man kann ja mal darauf hinweisen, dass es in Kriminalromanen hin und wieder nützliche Wahrheiten gibt. Dass Kriminalromane manchmal merkwürdig passgenau in aktuelle Lagen erscheinen. Wie «Exodus aus Libyen» des französischen Zeichners, Schriftstellers und Journalisten Tito Topin.
Da steht irgendwann an einem verlorenen Posten mitten in der libyschen Wüste, gut 100 Kilometer von der rettenden Grenze zu Tunesien, eine relativ unwahrscheinliche Gruppe von Leuten zusammen. Wir schreiben das Jahr 2011 und der Bürgerkrieg gegen Gaddafi ist in vollem Gange. Französische Bomber fliegen Angriff auf Angriff. Da erhebt einer das Glas. «Sie wissen sehr wohl», sagt er, er heißt Hajj Ahmed und ist der sehr feinfühlige, sehr gebildete, geheimnisvolle, gefährliche Sandhurst-Zögling, der dem Posten in der Wüste vorsteht, «dass Kriege schon lang nicht mehr gewonnen werden.» Korea, Afghanistan, Irak, Israel, Palästina, Hutus-Tutsis – die Liste ist lang. Ob sie mit Syrien enden wird, kann man bezweifeln. Er stößt lieber auf die Liebe an, «bei der gibt es auch nur Verlierer, aber wenigstens entspricht das den Spielregeln».
Von einem gewissen Grad von Bitternis zu sprechen, wäre der Euphemismus der Woche. Kommen wir zur unwahrscheinlichen Gruppe, deren Geschichten diesen unwahrscheinlichen, unheimlichen Kriminalroman ausmachen, der natürlich gar keiner ist. Ein halbes Dutzend Leute, auf der Flucht in einem Land Cruiser. Ein Bankräuber, eine Frau, die dem Diktator, der in «Exodus in Libyen» bloß «Pourriture» (Sauhund) genannt wird, beiwohnte und ihn halb erstach, ein kanadischer Arzt, der ihn zusammenflickte, ein Pilot, der seinen Freund in den Tod flog, eine Schwangere, ein Flüchtling aus dem Tschad, ein Archäologe. Irgendwie haben sich ihre Leben berührt, jetzt sitzen sie gemeinsam im Nest fest. Die Rebellen kommen. Der Land Cruiser ist kaputt.
Topin, der 1932 in Casablanca als Sohn eines Polizisten zur Welt kam, lange in Brasilien lebte und (nicht sehr) bekannt wurde durch die Serie um Commissaire Bentchimoun, lässt sie selbst ihre kleinen Vorgeschichten erzählen. Als Einsprengsel in die existenzielle, zunehmend ins Irreale kippende Geschichte ihrer Fluchtbewegungen.
Der Ton ist hart. Über allem leuchten die Sterne, denen das alles egal ist. Das All ist kalt, Gott macht Pause. Das Licht ist schön, gibt den Schatten den Farbton von Lavendel. So etwas bekommt man nur in Jahrzehnten Unterricht und Erfahrung in franzöischem Polar, der frankophonen Spätausprägung des Hardboiled, hin. Wenn man seinen Camus gelesen hat und Nordafrika kennt und die Nachrichtenlagen und die Geschichten.
Ein gelber Hund geht um. So einen kennt man von Maigret. Da war sein Auftauchen auch schon kein gutes Zeichen. Hier verleitet er den irren Arzt zu einem Ausflug in die politische Philosophie: «Es ist einfacher, einen Hund zu verjagen als einen Diktator. Ein Stein reicht, damit er den Schwanz einklemmt und abhaut. Für einen Diktator braucht man die Zustimmung aller Nationen, man muss quatschen, warten, bis es Tausende von Toten gibt. Woraus folgt, dass es besser ist, von einem Hund regiert zu werden. Man wird hin leichter los, wenn er anfängt, sich für Gott in Person zu halten.»
Und dann kommt der Tod. Zu sagen, dieser Roman würde wie der Krieg keinen Sieger kennen, wäre aber gelogen. Ein bisschen was bleibt am Ende, Tito Topin ist da ein bisschen altersmilde, auf das sich anzustoßen lohnt. Ist vielleicht gelogen. Aber schön. Am Ende von soviel funkelnder Aussichtslosigkeit.
Elmar Krekeler, DIE WELT
Der Krieg und die Liebe. Schlachtfelder des Lebens. Vielleicht muss man Franzose sein, um so darüber schreiben zu können: „Sie wissen sehr wohl, dass Kriege schon lange nicht mehr gewonnen werden. Niemand ist als Gewinner aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen. Wer hat den Koreakrieg gewonnen? Der Norden, der Süden? Afghanistan, Irak, Israel-Palästina, die Hututs gegen die Tutsis, die Liste dieser aufreibenden Kriege, die letztendlich immer ohne Siege oder Besiegte enden, ist lang. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich lieber auf die Liebe anstoßen, dabei gibt es nur Verlierer, aber wenigstens entspricht das den Spielregeln.“
Der so spricht ist kein Pazifist, sondern Hajj Ahmet, Kommandant der libysischen Armee. Wir befinden uns mitten im libyschen Bürgerkrieg, 2011, in einem zerstörten Wüstennest, etwa 100 Kilometer von der tunesischen Grenze entfernt. Die versucht eine Gruppe von sechs Männern und zwei Frauen zu erreichen, in einem gestohlenen Land Cruiser, mit wenig mehr als Erinnerungen und ein bisschen Hoffnung im Gepäck.
Die seltsam zusammengewürfelte Truppe (hier muss der Leser ein wenig Toleranz gegenüber UNwahrscheinlichkeiten aufbringen) – darunter ein kanadischer Arzt, ein französischer Fälscher, ein libyscher Lehrer und eine Ex-Geliebte Gaddafis – hat eigentlich keine Chance. Der Wagen geht kaputt, untereinander ist man zerstritten und dann ist da eben noch Hajj Ahmet, der die Gruppe an der Weiterfahrt hindert. Als der erste von ihnen von den Soldaten ermordet wird, scheint es als einzigen Ausweg nur noch den Tod zu geben…
Ein seltsamer, ein aufregender Hybrid ist dem Franzosen Tito Topin, dessen frühere Romane in Deutschland nicht übersetzt oder längst out of print sind, mit „Exodus aus Libyen“ gelungen: Halb Actionreißer, halb existenzialistisches Drama, hoch spannend, politisch und voller kluger Gedanken über den Krieg und was er mit den Menschen anstellt.
www.krimi-welt.de